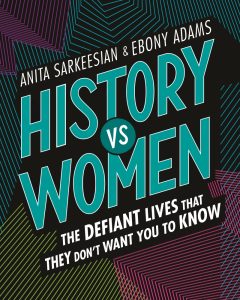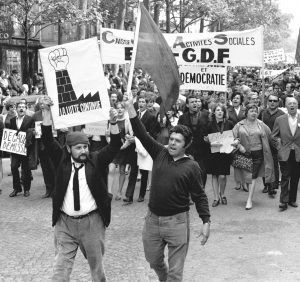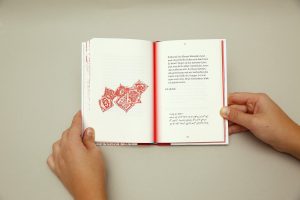Transkript des Redebeitrages bei der Re:publica 2015
Erst mal Hallo und Guten Morgen! Großartig, dass sich so viele um die Uhrzeit schon aus dem Bett geschält haben trotz wahrscheinlich guter After Party gestern. Ich wurde ja schon angekündigt und auch dass ich gerade ganz gut beschäftigt bin, unter anderem weil ich besagtes Buch herausgebracht habe, bin ich ziemlich viel unterwegs. Wer mir auf Twitter oder Instagram folgt, kriegt das gerade ganz gut mit. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und egal wo ich bin und welche Art von Veranstaltung es ist, ob es ein Vortrag ist oder ein Podium oder auch ein Workshop, den ich leite, irgendwann, meistens sogar ziemlich schnell kommen dann zwei Fragen. Die erste ist: Kriegst du immer noch Hasskommentare? Und die zweite ist: Wie gehst du mit Hasskommentaren um? Während die erste Frage zwar nicht wirklich befriedigend aber immerhin einfacher zu beantworten ist: ja, ich kriege noch Hasskommentare, und die Frage ist eigentlich immer eher nur, ob’s mal mehr oder mal weniger sind, lässt sich die zweite Frage leider nicht so leicht beantworten. Was besonders schwer ist, vor allem junge Frauen melden sich mit dieser Frage bei mir, und dann ist die Antwort natürlich umso schwerer. Denn eigentlich sind diese Frauen bereits begeistert vom Netz, wollen mehr damit machen, wollen damit ihre Arbeit publizieren, wollen schreiben, wollen Fotos veröffentlichen, Videos, Veranstaltungen machen, sich an Diskussionen beteiligen und stecken in der Regel einfach voller wunderbarer Ideen. Gleichzeitig befürchten sie aber, einfach durch die bloße Präsenz im Netz ungewollt Hassattacken ausgesetzt zu werden. Und dann sitze ich da oder stehe und möchte ihnen eigentlich weiter von den Großartigkeiten des Internet vorschwärmen, von dem Netz, das mir so viele unersetzliche Freundschaften beschert hat, die sich mühelos über mehrere Kontinente sogar erstrecken. Ich möchte von dem Netz erzählen, das mir meine Stimme sozusagen gebracht hat, mich zum Bloggen gebracht hat. Und schließlich auch zu Veranstaltungen wie dieser hier, kleiner Shout-out an alle, die auch schon 2007 dabei waren. Das Netz, von dem ich erzählen möchte, ist das, was mich politisiert hat, das mir gezeigt hat, dass ich selbst Teil des Wandels sein muss, wenn ich etwas in dieser Welt verändern möchte.
Aber stattdessen muss und möchte ich natürlich auch ehrlich bleiben, stattdessen geht es dann um die harte Realität. Es geht dann um Fragen wie: Kann ich die Impressumspflicht im Blog irgendwie umgehen? Sollte ich besser von Anfang an ein Pseudonym im Netz benutzen? Wenn ich dann offline Vorträge halte und ein Pseudonym benutze, werde ich dann überhaupt ernst genommen? Reicht es nur zu bloggen? Muss ich auch Screenshots machen? Wie reagiere ich bei anonymen Drohungen? Was mache ich eigentlich in so einem Shitstorm? Und so weiter und so fort. Ich finde nicht, dass diese Fragen sein sollten und dass Menschen sich diese stellen müssen, bevor sie sich im Netz einbringen. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns nicht nur offen eingestehen, dass unsere derzeitige Online-Kultur kaputt ist, sondern auch dass es dringend notwendig ist, Lösungen zu entwickeln, kurzfristige wie langfristige. Daher ganz im Sinne des Songs, der diesem Titel den Namen gab: Let’s talk about Meinungsfreiheit, Baby! Let’s talk about you and me. Let’s talk about all the good things and the bad things that may be.
Beginnen möchte ich dabei mit den sprachlichen Begriffen und mehr oder weniger der Definition, die sich rund ums Thema Gewalt im Netz und Hasskommentare etabliert haben und das ganze leider auch nicht immer ganz einfach machen, um darüber zu sprechen. Obwohl Sprache diesbezüglich natürlich sehr wichtig ist. Fangen wir also quasi beim Punkt Einself an, der Meinungsfreiheit. Sie bezeichnet das Recht der freien Meinungsäußerung. Artikel 5, Absatz 1 im Grundgesetz besagt: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt.“ Eigentlich ziemlich easy. Aber einige Menschen verwechseln das trotzdem immer noch damit, dass ihre Aussagen in einem mehr oder weniger gesellschaftlichen Vakuum existieren und daher auch nicht kritisiert werden dürfen, wenn sie zum Beispiel sexistisch, rassistisch oder auch feindlich gegenüber Homosexuellen sind. Es gibt einen großartigen (?) Comic, den haben wahrscheinlich auch schon alle hier gesehen, ich zeige ihn trotzdem noch einmal, weil der so gut ist, der sehr schön erklärt wie dieses Prinzip der Meinungsäußerungsfreiheit, wie es ja eigentlich noch konkreter heißt, funktioniert. Nur zur Erläuterung: ich habe die deutsche Übersetzung des Sprachwissenschaftlers Anatol Stefanowitsch gewählt, weil der sich natürlich auch auf den europäischen Rechtsrahmen bezieht. Da heißt es: „Wichtige Durchsage: das Recht auf freie Meinungsäußerung besagt, dass die Regierung dich für das, was du sagst, nicht verfolgen darf. Es besagt nicht, dass sich irgendjemand dein Gefasel anhören oder dir dafür Speicherplatz zur Verfügung stellen muss. Artikel 11 der EU-Grundrechte-Charta schützt dich nicht vor Kritik oder Reaktionen. Wenn du angeschrien oder boykottiert wirst, man deine Sendung absetzt oder dich aus einem Internetforum ausschließt, ist das keine Verletzung deiner Meinungsfreiheit. Es bedeutet nur, dass die Leute, die dir zuhören, dich für ein Arschloch halten und dir zeigen, dass du nicht willkommen bist.“
Der nächste Begriff, über den wir selbstverständlich sprechen müssen in diesem Rahmen, ist der der Hate Speech. Dieser ist gut erkennbar englisch und steht für Hasssprache, Hassrede, Volksverhetzung. Das deutsche Wort Hassrede ist bislang nicht so etabliert und die Debatte rund um diese Themen ist vor allem US-amerikanisch geprägt. Daher benutze auch ich diesen Begriff, zumal der sich auch mittlerweile im Deutschen immer mehr etabliert hat. Und dazu nur eine Anmerkung: es ist kein sprachwissenschaftlicher Begriff, sondern ein politischer. Kurz zur Definition: Hate Speech bezeichnet Formen sprachlicher Ausdrucksweisen, die eine Person oder eine Gruppe von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion, sexuellen Orientierung oder Herkunft erniedrigen, einschüchtern oder zur Gewalt gegen sie aufstacheln. Das kann schriftlich, mündlich, in Bildform, in Massenmedien und damit natürlich auch im Internet passieren. Hate Speech ist also kein Phänomen, das erst durchs Netz entstanden ist, aber das wir durch die technischen Möglichkeiten, die sich durchs Netz ergeben, noch mal neu diskutieren müssen. Eine feste Definition oder auch Sammlung von Hate Speech-Wörtern gibt es nicht, da Hate Speech auch immer im jeweiligen Kontext betrachtet werden muss. In der übrigens sehr lesenswerten Broschüre der Amadeu Antonio Stiftung, die jüngst zum Thema Hate Speech erschienen ist und die ich euch hier wirklich zur weiteren Lektüre wärmstens ans Herz legen möchte, werden folgende Elemente von Hate Speech aufgezeigt: Gleichsetzung wie zum Beispiel: „die Schwarzen gleich Afrika“; Verschwörungstheorien wie zum Beispiel: „Israel hat einen Anschlag auf die eigene Bevölkerung inszeniert, um von der Kritik an der Außenpolitik abzulenken“; De-Realisierung, also eine verzerrte Wahrnehmung und Falschaussage wie: „Alle Politiker hassen Deutschland“; eine Gegenüberstellung von „wir“ und „ihr“ als Gruppen; und das Konstruieren eines Handlungszwanges wie zum Beispiel: „Wenn wir uns von denen weiter auf der Nase herumtanzen lassen, werden wir alle sterben“; und Normalisierung von bestehenden Diskriminierungen wie zum Beispiel: „Ist doch kein Wunder, dass die Schwarzen so behandelt werden“. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und andere Formen von Diskriminierung existieren auch im Netz weiterhin – schließlich lösen sich entsprechende Machtstrukturen, die ja auch außerhalb der Bildschirme wirken, nicht einfach in Einsen und Nullen auf. Dieser Wunsch war am Anfang des Internets mal da, hat sich aber nicht erfüllt. Durch Hate Speech wird in erster Linie ein Klima geschaffen, in dem die Hemmschwellen, um Gewalt gegen bestimmte Personengruppen auszuüben, gesenkt werden. Gewalt gegen Menschen, die der jeweiligen Gruppe angehören, ist dann gesellschaftlich akzeptierter, was wiederum durch einen Mangel an Empathie noch mal manifestiert wird. Hate Speech dient also zur Entmenschlichung der betroffenen Personen.
Ein weiterer Begriff, der in der Debatte auftaucht und den ihr bestimmt auch alle kennt, ist der gute alte Shitstorm, mittlerweile sogar definiert im Duden als – ich zitiere – „Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht“. Ich finde dieses „zum Teil“ immer sehr charmant [lacht]. Nun steht dieser Begriff zwar schon im Duden, aber die allgemeine Verbreitung hat einerseits dazu geführt, dass der Begriff mittlerweile geradezu inflationär gebraucht wird, also dass im Grunde bei drei negativen Artikeln zu irgendeinem Zeitungsartikel gleich von einem „Shitstorm“ geredet wird. Andererseits werden dann auch gezielte Hasskampagnen gegen einzelne Personen oder Personengruppen durch die Bezeichnung „Shitstorm“ geradezu verharmlost. Ein Unternehmen auf Social Media-Kanälen für einen sexistischen Werbespot zu kritisieren, ist schließlich etwas anderes als Aktivistinnen zu sagen, dass sie einfach mal wieder „ordentlich durchgefickt gehören“ und ihnen bei nächster Gelegenheit mit dem Messer aufgelauert wird. Die Machtebene ist eine ganz andere, wenn in der Regel ein Team hinter dem Unternehmens-Account steckt und Social Media-Auftritte betreut, die Leute nicht mal persönlich in Erscheinung treten müssen und sie sich auch beim Krisenmanagement abwechseln können. Das hat dann im Übrigen auch nichts damit zu tun, dass Menschen an den Pranger gestellt werden, sondern hier wird lediglich Social Media genutzt, um öffentlich Kritik zu üben. Beleidigungen, Diffamierungen und Drohungen können natürlich auch innerhalb eines Shitstorms auftreten, aber wenn Hasskommentare oder auch Emails zum Grundton des digitalen Alltags werden, bekommt das alles eine andere Dimension und wir müssen schließlich von Hasskampagnen sprechen.
Ein weiterer Begriff, der die Debatte prägt, aber leider auch schwierig ist, ist der des Trollens. Warum der nicht so geeignet ist? Nun, dazu vielleicht mal eine kleine Liste, auch noch nicht vollständig, was derzeit unter anderem alles unter „Trollen“ verstanden wird: Das sind dann Beleidigungen, Verleumdungen, üble Nachrede, Stalking, Fälschung von Accounts und Verbreitung gefälschter Informationen, Verbreitung von Nacktbildern, das sogenannte Doxing, also wenn private Daten wie jetzt zum Beispiel die Adresse einer Person im Netz veröffentlicht werden, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kontaktiert werden, um die betreffende Person dort zu diffamieren, wenn Gewalt angedroht wird, das natürlich nicht nur auf einzelne Personen bezogen sondern auch auf deren näheres Umfeld wie zum Beispiel die Familie, wenn mit Mord gedroht wird, oh und natürlich: ursprünglich stand das ja auch mal für ein bewusstes Stören von Kommunikation im Netz und Provokation von Gesprächsteilnehmer_innen. Wie man also ganz gut sehen kann, wird da einiges in einen Topf geschmissen, was eigentlich eine differenziertere Auseinandersetzung verdient und durch diese „Ich mach doch nur Spass“-Implikation des Troll-Begriffs schlicht nicht ernst genug genommen wird. Außerdem wird beim Troll-Begriff nicht unterschieden, ob es sich um Mitläufer und Mitläuferinnen handelt oder um Agitator_innen, die maßgeblich dazu beitragen, dass die kritische Masse für eine Hasskampagne überhaupt erst erreicht wird. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte sich die Hater-Typologie von Yasmina Banaszczuk anschauen, die in besagter Broschüre zu Hate Speech übrigens auch noch mal in ausgefeilter Form zu finden ist.
Zusätzlich haben wir ein Problem mit unserer Online-Kultur an sich. Denn nicht nur der Begriff des Trollens sondern auch das „Don’t feed the Troll“ als Mantra hat sich etabliert. Das heißt, feindseligen Kommentaren soll einfach keine Beachtung geschenkt werden, damit diejenigen Menschen das Interesse an ihrem Angriffsziel verlieren. Dies führt leider zu einer toxischen Online-Kultur. Denn wer angegriffen wird, darf sich dadurch nicht mal mehr darüber beschweren, denn spätestens dann ist die Person, wenn sie sich beschwert, eben selber schuld, wenn es auch noch schlimmer wird. Solidarität mit den Betroffenen wird dadurch schier unmöglich statt selbstverständlich zu sein. Hier zeigt sich schließlich auch das Ausmaß der Taktik von Hasskommentaren. Gerade marginalisierte, also an den Rand der Gesellschaft gedrängte Menschen, die sich im Netz die Möglichkeiten von Plattformen zu nutze machen und eine Gegenöffentlichkeit für ihre Lebensperspektiven schaffen, sollen bewusst wieder aus dieser Öffentlichkeit verdrängt werden. Sie sollen zum Schweigen gebracht werden. Es geht bei Hate Speech also nicht um bloße „Kritik“, wie es dann gerne mal verschleiert dargestellt wird. Hasskommentare sollen zermürben, Angst machen, isolieren und die betreffenden Menschen am Ende zum Schweigen bringen. Und auch wenn den Drohungen vielleicht keine physischen Angriffe nachgehen, sind die Folgen für die Betroffenen von Hasskommentaren fatal. Die Worte haben bereits Gewalt ausgeübt, sie haben bereits verletzt. Folgen sind unter anderem Selbstzensur, Schlafstörungen, Essstörungen, Hilflosigkeit, Angst, Scham, Verunsicherung, emotionale Belastung. Das sind nur einige mögliche Resultate und die zeigen auch eindeutig, dass der psychische Stress auch immer in Verbindung mit körperlichen Beschwerden einhergeht. Betroffene Menschen werden durch diesen entmenschlichenden Akt der Hate Speech zu reinen Projektionsflächen. Wie sich das unter anderem anfühlt, hat dieses Selfie von Zoe Quinn auf, finde ich, sehr traurig-schöne Weise eingefangen. Die Videospielentwicklerin Zoe Quinn war das erste Ziel von Gamergate und wird seit August 2014 belästigt und bedroht und das zwar täglich, August 2014. Der Text auf dem Bild lautet: „The light inside has broken but I still work”. In diesem Zusammenhang sind dann auch Äußerungen und Attitüden wie “das sind doch nur so ein paar durchgedrehte Menschen im Internet“ und „Leg dir halt eine dickere Haut zu“ oder „Du brauchst dann erst gar nicht im Netz zu sein“ mindestens zynisch zu nennen. Davon abgesehen: danke für den Tipp, meine Haut ist schon dick genug. Trotzdem wüsste ich nicht, wie die Tatsache, dass jeden Tag mit einer Vergewaltigungsdrohung zu rechnen ist, als akzeptabler Netzalltag gewertet werden könnte. Die Beschimpfungen, Belästigungen und Bedrohungen sind real, nicht virtuell. Die damit einhergehenden Ängste sind es ebenso. Am Beispiel der Popkultur-Kritikerin Anita Sarkeesian sieht man auch ganz gut, wie sehr sie gerade darum kämpfen muss, weiterhin als Mensch betrachtet zu werden. Und das im Übrigen nicht nur gegenüber den Leuten, die sie täglich angreifen, sondern auch gegenüber denen, die sie unterstützen. Sie wird förmlich zu einer unzerstörbaren Heldin inszeniert und verliert wiederum auf diese Art ihre Menschlichkeit. Das ist ein mir sehr wichtiger Punkt, den ich immer wieder zu bedenken geben möchte. Wer unterstützen möchte, tut das auch nicht auf diese Art und Weise.
Fakt ist, wer im Netz nicht nur konsumieren sondern auch partizipieren möchte, insbesondere auf politischer Ebene, muss in einem gewissen Maß sichtbar werden und das macht wiederum angreifbar. Eine Studie des Pew Research Centers für Internet, Science & Tech aus dem letzten Jahr bestätigt das Offensichtliche: nämlich dass insbesondere junge Frauen Belästigungen im Netz ausgesetzt sind, vor allem durch Stalking, da sind es 26%, und sexuelle Belästigung, 25%. Hate Speech ist aber wie gesagt kein neues Problem, aber mit den Weiterentwicklungen rund um die Plattformen wie Facebook oder eben auch Twitter und andere Plattformen werden diese mittlerweile gezielt für Hasskampagnen eingesetzt. Dazu kommt das Problem, dass diese Plattformen und natürlich die größten ihrer Art sowieso in der Regel von weißen Männern aufgebaut wurden und werden, also einer Gesellschaftsgruppe, die am wenigsten von struktureller Diskriminierung betroffen ist und dementsprechend beim Entwickeln der Produkte das Worst Case Scenario von Online-Attacken nicht einkalkuliert hat. Die Diversity Reports von Twitter aber auch von Facebook, nur mal als Beispiel, fallen halt auch entsprechend aus. Und intern sieht’s dann so aus. [eingeblendet werden zwei Schlagzeilen: „Twitter is facing a class action lawsuit for gender discrimination“ und „Facebook is sued for sex discrimination, harassment“] Wenn Plattformen aber auf freie Meinungsäußerung pochen und wiederum nicht bei den Nutzern und Nutzerinnen hart durchgreifen, die zum Beispiel Vergewaltigungsdrohungen an eine feministische Aktivistin schicken, dann ist das nicht neutral und sie haben sich damit bereits positioniert und zwar auf der Seite der Belästigung. [eingeblendet wird das Zitat: „Completely deregulated speech (is) neutral for the people who have power. It’s not neutral for me.” (Jaclyn Friedman)] Die Ressourcen, um Lösungen gegen Online-Belästigung zu entwickeln, sind allerdings auch schon jetzt vorhanden. Und es gibt bereits Rufe nach möglichen Industriestandards für Plattformen. Ich denke auch, das wäre ein ganz guter Ansatz. Letztendlich aber sind Gegenwehr und Schutz – als Einzelperson gerade auch – Luxus in Anbetracht der Zeit und mentalen Kapazitäten, die sie wiederum kosten, und natürlich auch der technischen Kenntnisse, die mitunter immer noch erforderlich sind. Dabei sollte die Verantwortung für den Umgang mit Online-Bedrohungen nicht ausschließlich auf den Schultern der Menschen lasten, die diese Bedrohungen erhalten haben. Dass dies derzeit so ist, wird natürlich auch bei den Angriffen einkalkuliert. Und machen wir uns nichts vor, auch Plattformen schlagen Kapital daraus, dass es Hassbewegungen wie zum Beispiel Gamergate gibt und der Traffic dann schön am Laufen gehalten wird. Wir haben gesehen, erst wenn die PR dauerhaft schlecht ausfällt, bewegt sich bei den Unternehmen etwas. Das zeigt wiederum ein grundlegendes Problem, dass Profitmaximierung über das Wohlergehen der Nutzerinnen und Nutzer geht.
Ein weiterer Punkt, der natürlich eine Rolle spielt in der ganzen Debatte, ist die Rechtsordnung. Hier gibt es in Bezug auf Hate Speech zwar den Volksverhetzungsparagraphen § 130 Strafgesetzbuch und auch allgemeine Gesetze, die vor Beleidigung schützen. Doch Hate Speech zeigt sich oft in vermeintlich rationalen Aussagen, die wiederum eindeutig außerhalb des justiziablen Bereichs liegen und trotzdem problematisch sind, weil sie zum Beispiel mit falschen Fakten rechter Propaganda in die Hände spielen. Kurze Frage: wer hier im Saal wüsste sofort, was zu tun ist, wenn auf Twitter eine Morddrohung eingeht? … Danke. Wer würde sich sicher dabei fühlen, mit dieser Morddrohung zur nächsten Polizeiwache zu gehen und auch das Gefühl haben, dass die wissen, was Twitter ist? … Exakt. Genau an diesem Problem zeigt sich sehr gut, dass der sogenannte Digital Divide auch im Bereich der Strafverfolgung sehr groß ist, in einem Bereich, wo meistens die Dienstemails noch alle ausgedruckt werden.
Und hinzu kommt natürlich, wenn wir über das Thema Gesetze reden und überhaupt Rechtsmöglichkeiten, dass der Hass, die Verleumdung im Netz dokumentiert bleiben, sie sind nicht ausgesprochen, sie sind immer noch da und sie prägen damit auch den digitalen Fußabdruck derjenigen, die davon betroffen sind. Das kann dann Auswirkungen haben, wenn man dann zum Beispiel beim nächsten Jobgespräch plötzlich auf einen Blogpost angesprochen wird, der eben in den Suchergebnissen leider eher weiter oben landet. Wenn man natürlich das Glück hat, überhaupt erst zum Jobgespräch eingeladen zu werden. Das Problem im gesetzlichen Bereich ist wiederum, dass es als Einzelperson gerade wenn es eine Dauerattacke gibt, schon kaum möglich ist, diese alleine zu bewältigen. Wie soll man diese erst alle einzeln prüfen und dann noch gegebenenfalls anzeigen? Das ist eine Realität, die bisher noch nicht in den Gesetzen, die wir haben, abgebildet ist. Insofern brauchen unsere Gesetze diesbezüglich ein schlichtes Update. Und die Einführung eines Straftatbestandes Cybermobbing wie ihn die Juristin Dagmar Freudenberg vom Deutschen Jurist_innenbund fordert, könnte hier auch weiterhelfen. Bis es dergleichen geben wird, werden aber voraussichtlich noch so einige Statusupdates gepostet werden und natürlich muss auch klar sein, Gesetze können nicht alles lösen, erst recht, wenn die Mühlen entsprechend langsam mahlen und dann noch im Verhältnis zur Internetzeit.
Natürlich müssen wir auch zusätzlich immer noch lernen und verstehen, was die Kommunikation über Bildschirme mit uns überhaupt macht, dass unsere Gehirne so verdrahtet sind, dass sie Botschaften, die uns online erreichen, in einem Bereich verarbeiten, der unsere ureigenen Instinkte anspricht und damit erst mal auf einen Verteidigungsmodus schaltet, weil uns schlicht Mimik, Gestik und Tonfall fehlen. Hinzu kommt natürlich auch die gefühlte Anonymität und Straffreiheit auch als Online-Disinhibition-Effekt bekannt, also eine Enthemmung des Verhaltens. Gerade im Bereich der Mitläuferinnen und Mitläufer bei Hasskampagnen ist dies sehr relevant. Hate Speech ist in der Debattenkultur ein Problem, dem wir begegnen müssen. Und Medienkompetenz kann nur mit Zivilcourage und einer eindeutigen Positionierung gegen Hate Speech funktionieren. Unter diesem Punkt, der Medienkompetenz, sehe ich übrigens auch die Verantwortung und Kompetenz journalistischer Medien gefordert, die sich natürlich auch durch ihre eigenen Kommentarspalten leiten lassen und das dortige aggressive Klima entsprechend moderieren müssen, damit erstens sich überhaupt Leute beteiligen und nicht der Eindruck entsteht, das wäre die Meinung der Masse. Online-Debatten sind meinungsbildend und wenn dort eine hasserfüllte Einstellung dominiert, kann das schlicht andere beeinflussen. Oft passiert das schon beim ersten Kommentar, der dann den weiteren Verlauf der Diskussion bestimmt. Weiterhin sehe ich bei Medien die Verantwortung, dass sie die Gewalterfahrung der Betroffenen von Online-Attacken nicht als Click-Bait benutzen, um ihre Sensationsgier zu stillen. Es reicht nicht, diese Beiträge zu machen und zu sagen „oh schlimm, was der passiert ist“. Betroffene sind auch immer Expertinnen und Experten ihrer Situation und müssen auch als diese gehört werden. Davon abgesehen, kleiner Hinweis: für Shitstorms zu schreiben ist kein Journalismus.
Aber das Positive: auch aus der Not heraus bilden sich gerade neue Netzwerke, Initiativen wie das Crash Override Network, wie die Online Abuse Prevention, wie Heartmob, das gerade noch gefördert wird und wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, könnt ihr den Kickstarter gerne besuchen. Dies sind in der Regel Initiativen von Betroffenen, die einfach gemerkt haben, dass es nicht mehr anders geht, dass sie das selber in die Hand nehmen müssen, dass die Plattformen, die sie gerne mögen und eigentlich benutzen möchten für ihre Arbeit, nicht den Job machen, den sie eigentlich machen sollen. Und wir müssen uns bei diesen Initiativen immer wieder vor Augen führen, das sind Leute, die das in der Regel ehrenamtlich tun oder zumindest mit kleinem Budget und gerade letztendlich Pionierarbeit leisten. Insofern finde ich, sollten wir das unterstützen, an jeder möglichen Ecke, wo es geht.
Um das zusammenzufassen: Ich sehe hier also ein eindeutiges Zusammenspiel aus verschiedenen Ebenen, eben den Plattformen, der Rechtsordnung, der Medienkompetenz und auch einem Kulturwandel. Was ich damit meine, wenn es um Hate Speech geht, habe ich angeschnitten, wenn es um tatsächliche Kritik geht – wie gesagt: Hate Speech ist nicht Kritik – brauchen wir wiederum ein Wertesystem, das mit den Gegebenheiten des Netzes umgehen kann und ebenso respektvollen Umgang miteinander in den Mittelpunkt rückt. Ein Wertesystem, das auf Empathie basiert und auch Raum fürs Fehlermachen lässt und uns daran wachsen lässt. Wir brauchen Ideen, wie Entschuldigung aber auch Verzeihen im Social Media-Zeitalter funktionieren können. Das Internet ist ein Lebensraum, eine Entwicklung, die eindeutig zunimmt und nicht ab, allein schon durch die weiter steigende mobile Nutzung des Netzes. Das hat auch nichts mit Digital Natives zu tun, sondern schlicht damit, dass das Netz immer weiter in unseren Alltag integriert wird. Die bislang immer noch strenge Aufteilung in Online und Offline sollte daher dem allgemeinen Verständnis weichen, dass Online und Offline stets verschränkt miteinander sind. So ist auch Gewalt im Netz ein Abbild der strukturellen Diskriminierungen, die unsere Gesellschaft abseits der Bildschirme durchdringen und immer noch prägen. Insofern ist es auch wichtig, dass Veranstaltungen wie diese hier nicht nur einen Code of Conduct einführen, sondern diesen auch einsetzen und damit die Community stärken. Auch das signalisiert das Wissen um die Verknüpfung von Online und Offline. Hasskommentare werden immer noch zu oft als Meinungsfreiheit verteidigt, während nicht auf die Menschen geschaut wird, deren Meinungsfreiheit dadurch beschnitten wird, dass Hasskommentare im Netz einfach hingenommen werden und wie sich das wiederum für das Leben offline auswirkt. Diese Probleme anzugehen ist Netzpolitik und gehört damit ebenso auf die Agenda, wo jetzt der Überwachungsskandal zu finden ist. Wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen und das Recht, nicht überwacht zu werden, müssen wir uns auch anschauen, wem die Äußerung der eigenen Meinung im Netz derzeit am problemlosesten möglich ist und wer dagegen vielleicht sogar ganz davon abgeschreckt wird, sich überhaupt einzubringen. Das Internet ist unser Arbeitsplatz, der Ort, wo wir Freundinnen und Freunde kennen lernen, sie regelmäßig treffen, der Ort, wo wir uns verlieben und wieder entlieben, wo wir Abschied nehmen und genauso neue Menschen in der Welt willkommen heißen, wo unsere Gedanken und Ideen eine Plattform finden, wo wir mit unserer Familie in Kontakt sind und uns an Katzenbildern erfreuen können ohne einen allergischen Schnupfenanfall zu bekommen wie in meinem Fall, der Ort, wo wir großartige Dinge zusammen auf die Beine stellen wie diese hier, unabhängig von Ort und Zeit. Die Dinge, die wir im Netz tun und erleben, haben immer Konsequenzen auf uns als Personen vor dem Bildschirm und andersrum können uns die Umstände außerhalb des Internets erst recht zu diesen bringen (?). Was ist ein Netz dagegen wert, in dem es selbstverständlich ist, dass Hasskommentare nicht nur zu erwarten sind sondern auch ausgehalten werden sollten? Ein „Geh doch woanders hin, wenn’s dir nicht passt“ ist schon lange keine Alternative mehr und ist es auch noch nie gewesen. Ich möchte ein Netz, das mir die Antwort auf die Frage „Wie gehst du mit Hasskommentaren um?“ direkt liefert – weil es sie nicht gibt. Dieses Netz brauchen wir für uns alle. Vielen Dank.